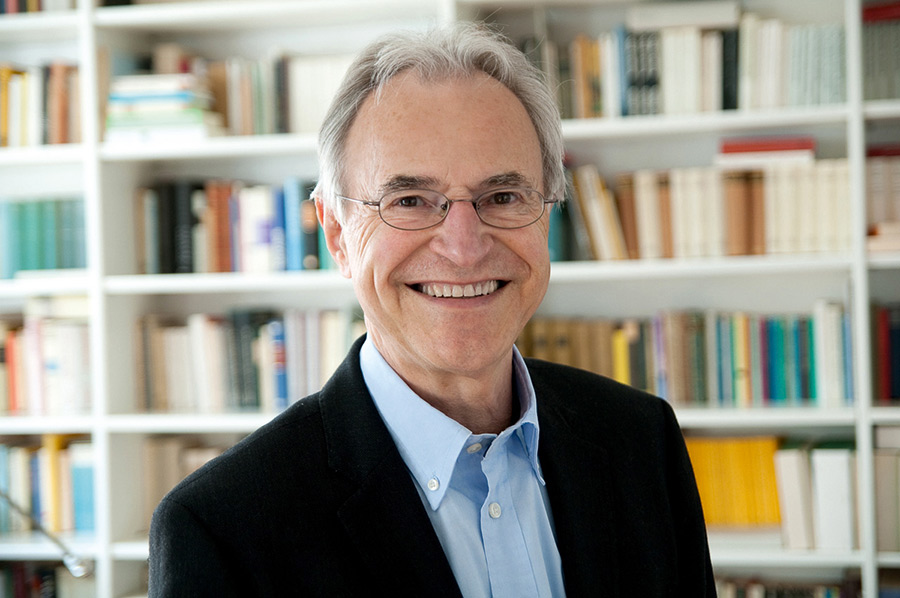Von Manfred Schneider
22.6.2022
22.6.2022
„Hunde, wollt ihr ewig leben?“, soll der preußische König Friedrich II.
während der Schlacht von Kolin 1757 seinen mutlosen
Grenadieren zugerufen haben. Ihre Antwort ist leider nicht
überliefert. Gut zweieinhalb Jahrhunderte danach soll sich die
gesamte Menschheit diese Frage in sprachlich etwas gehobe-
nerem Ton erneut stellen. Es nicht vielen bekannt, dass Google
unter dem neuen Dach der Alphabet Holding 2013 auch das Anti-Aging-Unternehmen Calico (California Life Company) gegründete hat.
Angeführt von dem Zukunftsdenker Ray Kurzweil, der sich täglich mit gut 150 Tabletten ewige Gesundheit zuführt, möchte Calico im Verbund mit anderen Biotechnologen eines der letzten Menschheitsübel schrittweise besiegen: Altern und Tod. Hurra, da wollen wir doch dabei sein! Wer möchte nicht, dass sich zu den vielen Wohltaten, die aus Googles Suchmaschinen quillen, selbstfahrenden Autos, Nanorobotern, Genreparaturen und definitiven Krebspräparaten, auch bald das Wundermittel gesellt, das Runzeln, Zittern, Vergessen, Leiden und vor allem Sterben aus unserem Schicksalsbuch streicht?
Sprechen wir nicht von den Nebenwirkungen des verlänger- ten Lebens, die dann ein langer Beipackzettel aufführen müsste, den Krisen des Bestattungsgewerbes und der Rentensysteme, blicken wir lieber in die Zukunft, was wir mit der gewonnenen Zeit anfangen werden. Um diese künftigen Zeiten der Langewei- le sorgen sich bereits Netflix und die wachsende Zahl der Streamingdienste. Man könnte meinen, dass auch die Dichterinnen und Dichter, feinfühlig, wie sie sind, diese künftigen unendlich langen Tage und Nächte mit Erzählen füllen wollen. Die Zahl der umfangreichen Romane, die die Leser durch viele Stunden eines verlängerten Lebens tragen könnten, hat in den letzten Jahren zugenommen.
Wie ein ironisches Echo auf Calicos ewige Zukunft jeden- falls klingt der Titel des 2015 erschienenen Romans A Little Life von Hanya Yanagihara, dessen gut 700 Seiten eigentlich eine ganze Menge Lebenszeit verschlingen. In ähnliche Lesezeitdimensionen führt Frank Witzels mehr als 800 Seiten dauernder preisgekrönter Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Bereits der Titel zeigt an, dass der Autor das Kurze und Kleine nicht schätzt.
Aber Hanya Yanagiharas und Frank Witzels Bücher wer- den noch übertroffen von dem 1000 Seiten langen Roman 2666 des chilenischen Schriftstellers Roberto Bolaño oder von David Foster Wallaces Infinite Jest oder von Thomas Pynchons Against the Day, die über 1500 Seiten zählen. Wollte man Ranglisten aufstellen, dann kämen die Parallelgeschichten von Péter Nádas’ mit 1700 Seiten ganz vorne an, allein noch überboten vom allergewaltigsten Romanwerk der letzten fünfzig Jahre, nämlich Zettels Traum von Arno Schmidt. Daneben oder auch dahinter fließen noch andere große Erzählströme wie Don DeLillos Underworld, Jonathan Franzens Freedom, Bora Ćosićs Die Tutoren oder auch wie die Serie autobiografischer Romane aus der ‚Feder‘ des norwegischen Autors Karl Ove Knausgård.
«Dass Du nicht enden kannst, das macht dich groß», schrieb Goethe in einem seiner Hafis-Gedichte. Womöglich ist die Selbstvergrößerungssucht eine der Triebkräfte für den Zug ins literarisch Monströse: die Ungeduld, der Unwille, auf die Kanonisierung und Denkmalwerdung durch die Nachwelt zu warten. Aber vielleicht liegt die Erklärung eher in einer veränderten Rolle der Literatur selbst, die heute nicht allein Stücke aus dem Weltgetriebe ausschneidet und im Erzählen vergrössert, sondern die Dichter und Leser der blanken Erfahrung der Zeit aussetzt. Zwar sitzen wir auf immer höheren Bergen des Wissens, die uns in die Unendlichkeit der Raumzeit, in die subatomare Struktur der Materie und in das neuronale Geschehen unseres Gehirns blicken lassen, die uns immer längere Lebenszeiten und vielleicht sogar Unsterblichkeit bescheren; dennoch wissen wir nicht, welche Pläne die Schöpfung einst mit uns hatte. Nichts wissen wir endgültig, oder vielmehr: Unser ohne Zweifel maßloses Wissen verschafft uns dennoch keine Gewissheit. Gegen die Ungewissheit greift man lieber nach den Weltverbesserungsnarkosen der Technik und Lebenserleichterung, und niemand befragt mehr die Künstler. Gewiss bieten die Buchstabenmeere der langen Romane keineswegs Ersatz für die Ungewissheit, sie flüstern uns keine Geheimnisse zu, vielmehr geben sie uns die Gewalt und Leere der Zeit zu spüren.
Allerdings soll uns die Zeit nicht minutenweise als glühendes Blei aufs Haupt tropfen, irgendetwas muss die Leser dazu treiben, in der langen Lesezeit auszuharren. Und was ist das? Was treibt sie ins Meer der Lettern? Was hält sie Tage, Wochen, Monate in den Erzählströmen aus tausend Ereignissen, ohne Angst, darin zu ertrinken, während ihnen doch, wie es vor vierhundert Jahren der Schriftsteller Robert Burton sagte, „die Augen vom Lesen und die Finger vom Umblättern schmerzen“? Leserinnen und Leser entziehen sich dem Wirbel der Veränderung und spüren unter den anflutenden Wörtern den Geschmack der Ewigkeit. Welche Beruhigung schenkt die verlässliche Stimme der Erzähler, auch wenn sie uns durch alle Höllen der Welt schickt! Den Dichterinnen und Dichtern, die ihr Leben im Fügen von Wörterketten zu nicht enden wollenden Romanen vertun, verdanken wir eine letzte Chance, die Macht der Zeit und die Lust des Dauerns zu erfahren.
Angeführt von dem Zukunftsdenker Ray Kurzweil, der sich täglich mit gut 150 Tabletten ewige Gesundheit zuführt, möchte Calico im Verbund mit anderen Biotechnologen eines der letzten Menschheitsübel schrittweise besiegen: Altern und Tod. Hurra, da wollen wir doch dabei sein! Wer möchte nicht, dass sich zu den vielen Wohltaten, die aus Googles Suchmaschinen quillen, selbstfahrenden Autos, Nanorobotern, Genreparaturen und definitiven Krebspräparaten, auch bald das Wundermittel gesellt, das Runzeln, Zittern, Vergessen, Leiden und vor allem Sterben aus unserem Schicksalsbuch streicht?
Sprechen wir nicht von den Nebenwirkungen des verlänger- ten Lebens, die dann ein langer Beipackzettel aufführen müsste, den Krisen des Bestattungsgewerbes und der Rentensysteme, blicken wir lieber in die Zukunft, was wir mit der gewonnenen Zeit anfangen werden. Um diese künftigen Zeiten der Langewei- le sorgen sich bereits Netflix und die wachsende Zahl der Streamingdienste. Man könnte meinen, dass auch die Dichterinnen und Dichter, feinfühlig, wie sie sind, diese künftigen unendlich langen Tage und Nächte mit Erzählen füllen wollen. Die Zahl der umfangreichen Romane, die die Leser durch viele Stunden eines verlängerten Lebens tragen könnten, hat in den letzten Jahren zugenommen.
Wie ein ironisches Echo auf Calicos ewige Zukunft jeden- falls klingt der Titel des 2015 erschienenen Romans A Little Life von Hanya Yanagihara, dessen gut 700 Seiten eigentlich eine ganze Menge Lebenszeit verschlingen. In ähnliche Lesezeitdimensionen führt Frank Witzels mehr als 800 Seiten dauernder preisgekrönter Roman Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Bereits der Titel zeigt an, dass der Autor das Kurze und Kleine nicht schätzt.
Aber Hanya Yanagiharas und Frank Witzels Bücher wer- den noch übertroffen von dem 1000 Seiten langen Roman 2666 des chilenischen Schriftstellers Roberto Bolaño oder von David Foster Wallaces Infinite Jest oder von Thomas Pynchons Against the Day, die über 1500 Seiten zählen. Wollte man Ranglisten aufstellen, dann kämen die Parallelgeschichten von Péter Nádas’ mit 1700 Seiten ganz vorne an, allein noch überboten vom allergewaltigsten Romanwerk der letzten fünfzig Jahre, nämlich Zettels Traum von Arno Schmidt. Daneben oder auch dahinter fließen noch andere große Erzählströme wie Don DeLillos Underworld, Jonathan Franzens Freedom, Bora Ćosićs Die Tutoren oder auch wie die Serie autobiografischer Romane aus der ‚Feder‘ des norwegischen Autors Karl Ove Knausgård.
Literarische Maßlosigkeit
Damit sind nur einige Beispiele für Erzählwerke genannt, die man einst „Wälzer“ nannte, als die durchschnittliche Lebenszeit aller Leser noch bei gut dreißig Jahren lag. Ein solcher Wälzer war der 1689/90 erschienene Roman Grossmüthiger Feldherr Arminius des Diplomaten Daniel Casper von Lohenstein mit über 3000 Seiten. Damals schrieben Gelehrte Romane, und man weiß, dass die gerne in Tinte schwammen. Aber auch seit hauptamtliche Dichterinnen und Dichter die Literatur in die Hände genom- men haben, entstanden ehrgeizige Riesenwerke wie Emile Zolas knapp 10 000 Seiten umfassender Romanzyklus Les Rougon-Macquart oder Marcel Prousts A la recherche du temps perdu, das acht Bände währende Erzählwerk von unerreichter Großartigkeit. Knausgård erzählt im ersten Band seines autobiografischen Großzyklus Sterben, wie nach der berauschenden Lektüre von Prousts Suche nach der verlorenen Zeit der Wunsch zu schreiben an ihm nagte „wie eine Ratte“. Sind nun alle Autoren, die solche Buchstabenmeere füllen, von Ratten genagt, oder was steckt hinter dieser über die Welt verbreiteten neuen literarischen Maßlosigkeit, solange das ewige Leben noch ein aberwitziges Techno-Versprechen bleibt?«Dass Du nicht enden kannst, das macht dich groß», schrieb Goethe in einem seiner Hafis-Gedichte. Womöglich ist die Selbstvergrößerungssucht eine der Triebkräfte für den Zug ins literarisch Monströse: die Ungeduld, der Unwille, auf die Kanonisierung und Denkmalwerdung durch die Nachwelt zu warten. Aber vielleicht liegt die Erklärung eher in einer veränderten Rolle der Literatur selbst, die heute nicht allein Stücke aus dem Weltgetriebe ausschneidet und im Erzählen vergrössert, sondern die Dichter und Leser der blanken Erfahrung der Zeit aussetzt. Zwar sitzen wir auf immer höheren Bergen des Wissens, die uns in die Unendlichkeit der Raumzeit, in die subatomare Struktur der Materie und in das neuronale Geschehen unseres Gehirns blicken lassen, die uns immer längere Lebenszeiten und vielleicht sogar Unsterblichkeit bescheren; dennoch wissen wir nicht, welche Pläne die Schöpfung einst mit uns hatte. Nichts wissen wir endgültig, oder vielmehr: Unser ohne Zweifel maßloses Wissen verschafft uns dennoch keine Gewissheit. Gegen die Ungewissheit greift man lieber nach den Weltverbesserungsnarkosen der Technik und Lebenserleichterung, und niemand befragt mehr die Künstler. Gewiss bieten die Buchstabenmeere der langen Romane keineswegs Ersatz für die Ungewissheit, sie flüstern uns keine Geheimnisse zu, vielmehr geben sie uns die Gewalt und Leere der Zeit zu spüren.
Vorher und danach
Einst hat die Literatur die Welt vernünftig geordnet, Gut und Böse geschieden und im Genuss des Schönen die Hoffnung auf eine bessere Welt genährt. Unsere literarische Hypermoderne hingegen setzt uns mit ihrem endlosen Erzählen allein der Erfahrung der Zeit aus. Alle Autoren, die wie Proust nur noch die Obsession des Schreibens ausleben und mit dem Ende des Romans ihr eigenes Leben ausgeleert hatten, spüren die Gewalt der Zeit. Die Leserinnen und Leser solcher lebenverzehrenden Ro- mane tun gut daran, sich vor Beginn der Lektüre zu fotografieren und dieses Bild mit einer Aufnahme am Ende des Lesens zu vergleichen. Im Intervall zwischen dem Vorher und dem Danach wirkt die Zeitgewalt der Literatur.Allerdings soll uns die Zeit nicht minutenweise als glühendes Blei aufs Haupt tropfen, irgendetwas muss die Leser dazu treiben, in der langen Lesezeit auszuharren. Und was ist das? Was treibt sie ins Meer der Lettern? Was hält sie Tage, Wochen, Monate in den Erzählströmen aus tausend Ereignissen, ohne Angst, darin zu ertrinken, während ihnen doch, wie es vor vierhundert Jahren der Schriftsteller Robert Burton sagte, „die Augen vom Lesen und die Finger vom Umblättern schmerzen“? Leserinnen und Leser entziehen sich dem Wirbel der Veränderung und spüren unter den anflutenden Wörtern den Geschmack der Ewigkeit. Welche Beruhigung schenkt die verlässliche Stimme der Erzähler, auch wenn sie uns durch alle Höllen der Welt schickt! Den Dichterinnen und Dichtern, die ihr Leben im Fügen von Wörterketten zu nicht enden wollenden Romanen vertun, verdanken wir eine letzte Chance, die Macht der Zeit und die Lust des Dauerns zu erfahren.